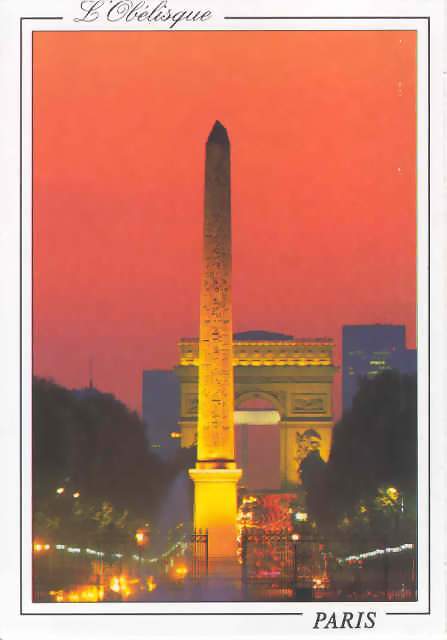Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Obelisk
- Ersteller Tourett
- Erstellt am
G
Guest
Guest
Onkel_Hotte
Meister
- Registriert
- 29. April 2003
- Beiträge
- 206
Also, der Obelisk in Washington wurde zu Ehren George Washingtons nach 40! Jahren Bauzeit 1885 fertiggestellt. Es ist übrigens gesetzlich festgeschrieben, dass kein Bauwerk in Washington höher sein darf als der Obelisk(155m), daher gibt es auch keine Skyscraper in Washington. Bekloppt, aber war!
Hallo
Leider wurde noch nichts über die Bedeutung eines Obelisken geschrieben...
Hab auch keine Lösung auf Lager, sonst wer?
Sieht ja aus wie ein Piephahn der ziemlich geil ist
 sagt mein Bauch....
sagt mein Bauch....
Weiss jemand was konkreteres!!
Viele Grüsse Willi
Leider wurde noch nichts über die Bedeutung eines Obelisken geschrieben...
Hab auch keine Lösung auf Lager, sonst wer?
Sieht ja aus wie ein Piephahn der ziemlich geil ist
Weiss jemand was konkreteres!!
Viele Grüsse Willi
GreatForrest
Meister
- Registriert
- 2. Mai 2002
- Beiträge
- 425
Neben den Pyramiden und den kolossalen Statuen sind wohl die Obelisken diejenigen Denkmäler, in denen sich dem modernen Geist "Altägyptisches" am typtischsten verköpert. Selbst ohne das Land am Nil bereist zu haben, wird doch jedermann die drei genannten Denkmälergruppen ohne weiteres dem pharaonischen Erbe zuorden: das Wissen darum ist zum selbstverständlichen abendländischen Kulturgut geworden. Die Aneignung freilich erfolgte keineswegs synchron und geradlinig: die Gegenständlichkeit der kolossalen Königsstauten erlaubte den nachpharaonischen Völkern keine konstruktive Auseinandersetzung, geschweige denn eine Übernahme dieser gewiss eindrucksvollen Monumente in die eigene Kultursphäre. Erst durch ihr Auffinden in originalen Kontexten seit dem 19. Jahrhundert sind sie als Symbol ägyptischer Kunst in unser Bewusstsein gerückt. Die über Jahrhunderte währende Einschränkung der Reisemöglichkeiten in den Orient hatte die Pyramiden, deren Bedeutung für den ägyptischen Totenkult der Antike bekannt gewesen war, zu mystischen Monumenten verklärt, einer Vorstellung, vor der wir uns bis heute nicht ganz frei machen können. Das Mittelalter sah in ihnen die Kornkammern, die Pharao auf Geheiss Josephs hat anlegen lassen, ohne sich über ihre wahre Gestalt und Grösse Rechenschaft abzulegen. Pyramiden hatten sich lediglich durch ähnlich gestaltete Nachbildungen in
Rom
erhalten.
Einzig die Obelisken sind dem Abendländer im Original allezeit vor Augen geblieben. Der Umstand, dass sie aus Hartgestein monolitisch geschlagen sind, und ihre einfache Form erlaubten bereits der Antike, viele von ihnen ohne übermenschlichen Aufwand nach Europa zu verbringen. Zunächst als reine Siegestrophäen verstanden, wurden sie- infolge ihrer abstrakten Form - schon bald in andere Sinnkontexte transportiert. Die Römer stellten sie in den Circus, als "Zeiger" auf die Sonnenuhr, vor Mausoleen oder direkt auf Gräber. Die altägyptische Weise der Aufstellung, nämlich ausschliesslich vor Tempeln, findet in Rom ihre Entsprechung in den
Isis-Heiligtümern
der Stadt, wo sie als Evokation des ägyptischen "genius loci" den Tempeln "authentisch"-ägyptisch" machen sollten.
Hier in Rom haben sie sich in den Ruinen der Stadt in einem Fall sogar noch aufrecht stehend, erhalten. Bei der Erneuerung Roms zum Zenturm der Christenheit sollten diese Monumente einer neuen Aufgabe zugeführt werden. Wieder war es ihre zeitlos abstrakte Form, die sie -Zeugen ältester Zeit- zu Sinnträgern im Dienst des universellen Christentums prädestinierte. Darüber hinaus spielen sie im urbanistischen Konzept der Renasissance und des Barock eine wesentliche Rolle als dekoratives Element. Sie erfuhren somit ihre zweite Reaktualisierung und entfernten sich weiter von ihrer ursprünglichen Bedeutung.
Was diese einmal war, konnte erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt werden, nachdem Napoleon Bonapartes Ägyptenfeldzug den Weg zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der pharaonischen Kultur frei gemacht hatte. Jetzt werden wieder Obelisken über weite Distanzen aus Ägypten geholt, um die Städte der neuen Industrieländer zu schmücken. Aber diesen Bemühungen liegt das Wissen um ihr Alter und ihre Bewandtnis zu grunde und sie werden als wirkliche Botschafter des Alten Ägypten eingesetzt. Der Obeliskengedanke wurde ein letztes Mal im grossen Stil exportiert, wobei zunehmend "Nachempfindungen" an die Stelle der ägyptischen Originale traten, die in ihrem Dimensionen und Implikationen über das Vorbild bisweilen weit hinaus gehen konnten.
Dr. Christian E. Loeben
Quelle: http://www.obelisken.com/Re.htm
Rom
erhalten.
Einzig die Obelisken sind dem Abendländer im Original allezeit vor Augen geblieben. Der Umstand, dass sie aus Hartgestein monolitisch geschlagen sind, und ihre einfache Form erlaubten bereits der Antike, viele von ihnen ohne übermenschlichen Aufwand nach Europa zu verbringen. Zunächst als reine Siegestrophäen verstanden, wurden sie- infolge ihrer abstrakten Form - schon bald in andere Sinnkontexte transportiert. Die Römer stellten sie in den Circus, als "Zeiger" auf die Sonnenuhr, vor Mausoleen oder direkt auf Gräber. Die altägyptische Weise der Aufstellung, nämlich ausschliesslich vor Tempeln, findet in Rom ihre Entsprechung in den
Isis-Heiligtümern
der Stadt, wo sie als Evokation des ägyptischen "genius loci" den Tempeln "authentisch"-ägyptisch" machen sollten.
Hier in Rom haben sie sich in den Ruinen der Stadt in einem Fall sogar noch aufrecht stehend, erhalten. Bei der Erneuerung Roms zum Zenturm der Christenheit sollten diese Monumente einer neuen Aufgabe zugeführt werden. Wieder war es ihre zeitlos abstrakte Form, die sie -Zeugen ältester Zeit- zu Sinnträgern im Dienst des universellen Christentums prädestinierte. Darüber hinaus spielen sie im urbanistischen Konzept der Renasissance und des Barock eine wesentliche Rolle als dekoratives Element. Sie erfuhren somit ihre zweite Reaktualisierung und entfernten sich weiter von ihrer ursprünglichen Bedeutung.
Was diese einmal war, konnte erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt werden, nachdem Napoleon Bonapartes Ägyptenfeldzug den Weg zu einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der pharaonischen Kultur frei gemacht hatte. Jetzt werden wieder Obelisken über weite Distanzen aus Ägypten geholt, um die Städte der neuen Industrieländer zu schmücken. Aber diesen Bemühungen liegt das Wissen um ihr Alter und ihre Bewandtnis zu grunde und sie werden als wirkliche Botschafter des Alten Ägypten eingesetzt. Der Obeliskengedanke wurde ein letztes Mal im grossen Stil exportiert, wobei zunehmend "Nachempfindungen" an die Stelle der ägyptischen Originale traten, die in ihrem Dimensionen und Implikationen über das Vorbild bisweilen weit hinaus gehen konnten.
Dr. Christian E. Loeben
Quelle: http://www.obelisken.com/Re.htm
BrettonWoods
Meister
- Registriert
- 5. Juni 2003
- Beiträge
- 327
Ein Obelisk ist ein hoher, vierkantiger Steinpfeiler, der sich nach oben hin verengt und in einer pyramidenförmigen Spitze endet. Die Ägypter benutzten sie für einen gezielten energetischen Transfer von Lichtenergien. Zwei nebeneinander stehende Obelisken beschreiben sehr augenfällig den Energiekreislauf der Bioenergien.
Ich finde es geradezu genial, wie hier ein Problem elegant gelöst wird. Der Hellsichtige sieht, daß bei einem Obelisken der Orgonstrahl aufsteigt und in einer entsprechenden Höhe im Bogen zurückgeführt wird und in den zweiten Obelisken zurückstrahlt. Beim Durchschreiten des Portals kann die Breite der Energiewand bioenergetisch genau abgegrenzt werden. Gleichsam in einem zweiten Bogen unten zwischen den Obelisken schließt sich der Kreislauf des Orgonstrahls im Fluß der Bioenergien. Der Eingang ist also bioenergetisch verschlossen.
Quelle: http://www.heilen-mit-mandalas.de/wdcab.htm
Ich finde es geradezu genial, wie hier ein Problem elegant gelöst wird. Der Hellsichtige sieht, daß bei einem Obelisken der Orgonstrahl aufsteigt und in einer entsprechenden Höhe im Bogen zurückgeführt wird und in den zweiten Obelisken zurückstrahlt. Beim Durchschreiten des Portals kann die Breite der Energiewand bioenergetisch genau abgegrenzt werden. Gleichsam in einem zweiten Bogen unten zwischen den Obelisken schließt sich der Kreislauf des Orgonstrahls im Fluß der Bioenergien. Der Eingang ist also bioenergetisch verschlossen.
Quelle: http://www.heilen-mit-mandalas.de/wdcab.htm
BrettonWoods
Meister
- Registriert
- 5. Juni 2003
- Beiträge
- 327
„An dem Tag an dem die Wissenschaft beginnen wird, nicht-physikalische Erscheinungen zu untersuchen, wird sie in einem Jahrzehnt größer Fortschritte machen, als in all den vergangnen Jahrhunderten"
Nikola Tesla, ein in Serbien geborener, amerikanischer Erfinder, sagte diese Aussage kurz vor seinem Tod
http://members.aon.at/rohof.peter/page7.html
Nikola Tesla, ein in Serbien geborener, amerikanischer Erfinder, sagte diese Aussage kurz vor seinem Tod
http://members.aon.at/rohof.peter/page7.html
BrettonWoods
Meister
- Registriert
- 5. Juni 2003
- Beiträge
- 327
Ja Du hast Recht!agentp schrieb:Nikola Tesla wurde nicht in Serbien geboren, sondern in Similjan im heutigen Kroatien.
Grüße
G
Guest
Guest
Weiss irgend jemand was auf den verschiedenen Obelisken der Welt steht ?
Habe über google nichts finden können.
danke.
Habe über google nichts finden können.
danke.
Tourett schrieb:istanbul
Obelisken
Der Ägyptische Obelisk:
Der mit eingemeißelten Hieroglyphen verzierte ägyptische Obelisk ist das älteste Monument in Istanbul. Er wurde in der Zeit 1490 vor Christus durch den Pharao Tutmoses III. im aegyptischen Luxor vor dem Karmak-Tempel zum Gedenken des Sieges in Mesopotamien aufgestelt. Im vierten Jahrhundert ließ Kaiser Theodosius I. den aus Rosengranit gefertigten Obelisk nach Konstantinopel schaffen. Die aus römischer Zeit stammenden Reliefs der Sockel zeigen die Vorkehrungen der Aufstellung des Monuments und Kaiser Theodosius im Kreise seiner Familie sowie weitere Szenen aus der römischen Epoche.
Es wird berichtet, dass der ägyptische Obelisk in jeder Epoche als magisch galt.
Quelle: http://www.tuerkeiteam.de/istanbul.htm
hab mal bei google die bildersuche bemüht und den folgenden interessanten Obelisken aus Washington gefunden...

er steht dort in der Uni (kurz UW -> U = V = 5 [im römischen alphabet/zahlensytem] ; W = 23. Buchstabe)
was sagt uns das jetzt?

er steht dort in der Uni (kurz UW -> U = V = 5 [im römischen alphabet/zahlensytem] ; W = 23. Buchstabe)
was sagt uns das jetzt?
Teilen: